Göttliche Begegnungen und Aufräumarbeiten der Robocops (Juli 2 – 4)
August 22, 2007
Themen: Venezuela
Unsere Abreise von La Mucuy gestaltete sich etwas schwierig. Dort oben bestand nämlich morgens um 7 Uhr keinerlei Transportmöglichkeit. Das hieß also für uns hinunterlaufen, zumindest bis zu dem Dorf La Mucuy. Eine Hoffnung hatten wir noch. Wir sahen ein junges Päärchen, das am späten Abend unbemerkt sein Zelt nahe dem unseren aufgebaut hatte. Nun packten sie, wie auch wir, ihr Hab und Gut zusammen und brachten alles zu ihrem Auto. Das war die perfekte Gelegenheit bis nach Tabay zu kommen. Wir versuchten also schnell zu sein, um die Beiden an der Strasse abzufangen. Wir hätten auch nachfragen können, wollten aber nicht aufdringlich wirken. Wir liefen die ersten Meter in Richtung La Mucuy, da tauchten sie mit ihrem roten Ford auf. Wir hielten lächelnd unsere Daumen hoch und hätten wirklich erwartet, dass… Sie nahmen uns nicht mit. Sie fuhren, auch lächelnd, an uns vorbei und obwohl sie in unserem Alter waren, kamen sie nicht im Entferntesten auf die Idee für uns anzuhalten. Etwas frustriert zogen wir weiter. Wie konnte das nur sein? Wir hatten fast Kopf an Kopf die Nacht im Park verbracht und nun ließen sie uns einfach stehen. Naja, weiter. Das nächste Auto kam. Darin sassen zwei der Waldarbeiter, die uns die vorherigen Tage bereits über den Weg gelaufen waren. Sie hatten sehr viel Platz in ihrem Wagen, doch fuhren auch sie einfach an uns vorbei. Und auch das dritte, unverhofft auftauchende Gefährt, in dem ein einzelner Herr saß, hielt nicht für uns an. Oh, war ich vielleicht frustriert! Ich kriegte es einfach nicht in meinen Kopf hinein, wie Leute, die um die Situation dort oben im Nationalpark wissen, uns einfach stehen lassen können, noch dazu da sie unendlich viel Platz in ihren Autos hatten. Verdammt nochmal! Das kann es doch gar nicht geben! Ich kochte vor Wut. Ich nahm mir vor, wenn wir an den Eingang zum Nationalpark La Mucuy kommen, werde ich den Waldarbeitern gehörig meine Meinung sagen. Und zwar ironisch-sarkastisch, damit sie ein für allemal verstehen, dass man sich dort oben gegenseitig helfen sollte! Als wir dann endlich den Eingang des Nationalparks zu Fuß erreichten, fanden wir niemanden vor, gar niemanden. Ich musste meinen Ärger also verrauchen lassen, ich konnte ihn ja eh nicht adressieren.
Wir kamen nach ca. 1 Stunde, das Gepäck auf die Schultern und in den Rücken drückend, die Beine heiss und schwach, endlich im Dorf La Mucuy an. Dort warf gerade einer dieser Safari-Transporter-Fahrer seine Maschine an. Wir baten ihn, uns kostenlos mitzunehmen, was er uns nicht erlaubte. “Ich befinde mich bereits auf Arbeit, ich bin nicht privat unterwegs.” Wir akzeptierten also den von ihm vernünftig angebotenen Preis von 2.000 Bolivar (0,80€) für uns beide und fuhren mit all den anderen, später am Straßenrand Wartenden bis hinunter nach Tabay.
In Tabay schien unser Ausgangspunkt etwas unglücklich, doch schafften wir es nach einer halben Stunde einen Lift zu bekommen. Der Herr war auf dem Weg nach Merida und hatte eine Flasche mit einem Vodka-Mixgetränk neben sich stehen. Er erklärte uns, dass er vom An- und Verkauf von Autos lebe und zudem einen Lebensmittelladen unterhielt, für den er in Merida etwas besorgen müsste. In seinem Auto lagen viele Aprikosen herum, von denen er uns großzügig naschen liess. Ich steckte meine Aprikose in die Tasche, da sie so dreckig war, dass sie erst einmal in die Reinigung musste.
In Merida wurden wir an einer grossen Strasse herausgelassen, die uns hoffentlich in Richtung Ejido, San Cristobal und letztlich zur venezuelanisch-kolumbianischen Grenze bringen würde. Wir mussten ein ganzes Stück laufen. Da sich wegen eines Staus eine lange Schlange voller Autos gebildet hatte, an denen wir zu Fuss vorbeizogen, schauten wir uns die Nummernschilder genau an. Da waren einige dabei, die uns näher nach Kolumbien bringen konnten. Wir fragten dann einfach drei junge Männer, die in einem Pick-Up unterwegs waren. Sie liessen uns einsteigen und nahmen uns bis in die Nähe von Ejido mit. Dort hieß es wieder lange Laufen und Klären, wo genau wir unsen Weg fortsetzen konnten. Leider gab es zwei Wege, die in unsere Richtung führten. Einen, der mitten durch der Kleinstadt Ejido ging, der andere, der Ejido nahezu umfuhr. Uns wurde angeraten, den zweiten Weg zu wählen, obwohl die meisten Fahrzeuge den ersten bevorzugten. Aber vielleicht wollten sie ja alle nur nach Ejido…
Da standen wir nun an einer Brücke in Ejido, die Sonne auf unserer Haut brennend. Endlich hielt jemand an, der nur ein kleines Stück weiter wollte. Wir erklärten ihm, wo wir hinwollten und er war bereit, uns bis zu einem sicheren Platz zu führen, an dem wir unseren Weg getrost per Anhalter fortsetzen konnten. “Hier”, meinte er, “wird euch sonst niemand mitnehmen.” Nun gut, wir stiegen ein und bald an einer grossen Strasse wieder aus. Die Strasse war auf beiden Seiten dreispurig und in der Mitte verkehrte ein niegelnagerneuer Trolleybus. Alles sah wie geleckt aus und erinnerte eher an eine europäische, als eine venezuelanische Erschaffung.
Da standen wir nun, mal wieder voll der Sonne ausgesetzt, an einer Ampel, an der der Verkehr dermaßen hoch war, dass wir außer Armkrämpfen mit dem Trampen nichts bewirkten. Noch dazu befand sich hinter uns eine Baustelle, in die ständig Baufahrzeuge hinein- und herausgelassen wurden. Und wir mussten dafür jedesmal unsere Position aufgeben. Da wir eh noch nicht am Ende von Ejido angekommen schienen (wir standen in einer Kurve, konnten also nicht sehen, was noch vor uns lag), sattelten wir eben wieder unser Gepäck auf und liefen ein paar weitere Kilometer. An einer Bushaltestelle vor einem Einkaufszentrum angekommen machten wir eine kurze Verschnaufspause. Wir stärkten uns und da sich auch dort keine Erfolge beim Trampen verzeichnen ließen gingen wir noch ein Stück weiter. Dann entschieden wir uns endlich für den Bus, denn Ejido schien nie zu enden. Mit dem Bus erreichten wir nahezu das Ende der Kleinstadt und watschelten den letzten Kilometer bis zu einer günstigen Anhalterstelle.
Dann endlich wurden wir belohnt. Ein Herr war auf dem Weg nach La Vigia. Wir konnten diesen Ort nicht in unserer Landkarte finden, ließen uns also erklären, wo mehr oder weniger die Kleinstadt lag. Mit dem sicheren Gefühl, dass wir uns auf dem richtigen Weg befanden, lehnten wir uns entspannt in unseren Sitzen zurück. Wir hörten des Fahrers Geschichte über die Paramilitäre zu, die er vor knapp 3 Jahren kurz hinter der Grenze von Kolumbien, in der Nähe von Puerto Santander, erlebt hatte. Die Paramilitäre nahmen ihm sein Auto ab und wollten seine Frau behalten, da sie einen sehr europäischen Einschlag hatte und sich damit gut als Gelddruckmittel gegen die Politiker einsetzen lassen würde. Ich weiss nicht mehr genau wie, aber am Ende ließen sie seine Frau in Ruhe. Unser Fahrer hatte auch ein unausgesprochen gutes Wissen über die Geschichte Venezuelas sowie Gran Colombia, das einst die Region von Venezuela, Kolombien, Panama und Ecuador umfasste und zu Simon Bolivar’s Zeiten existierte. Sein historisches Wissen wusste er immer Gedichten, Philosophien und Ansprachen von bekannten Persönlichkeiten zu untermalen. Er ließ uns auch das Versprechen abgeben, dass, sobald wir in Ekuador wären, wir auf jeden Fall am Grab von Sucre vorbeischauen würden. Plötzlich sahen wir eine Weggabelung. Für uns, die wir auf dem Weg nach San Cristobal waren, hieß es nach rechts abbiegen. Unser Fahrer aber fuhr weiter geradeaus, dessen Strasse uns bis La Vigia und später La Fria bringen sollte. Das war ein grosser Umweg, den wir nicht gerne in Kauf nehmen wollten. Wir baten ihn also anzuhalten, doch mit seiner Art Reden zu Halten kamen wir mit keinem Argument gegen ihn an. “Die meisten Autos fahren über La Vigia, es ist also besser wenn ihr dort aussteigt…” Jaja. Wir gaben auf. In La Vigia angekommen, ließ er uns an einer fürchterlichen Kreuzung heraus. Die gesamte Kreuzung war voller Autos, d
ie sich im Millimetertakt vorwärtsbewegten. Unser Fahrer deutete uns noch die Richtung an und weg war er.
Wir entfernten uns ein wenig von der Kreuzung und nahmen einen Bus bis zum Ende von La Vigia. Wieder mussten wir eine ganze Weile laufen, bis wir endlich eine gute Tramperstelle gefunden hatten. Es war heiss, die Strasse staubig, eine Menge Verkehr, die Luft verpestet mit Abgasen, wir hatten kaum noch einen Schluck Wasser, die Gegend wirkte sehr ausladend und wir waren mittlerweile nicht mehr sehr energievoll. Da wechselten wir die Strategie, wie wir es nennen, wenn wir beim Trampen etwas verändern. Mir stand schon das Wasser in meinen Bergschuhen, so dass ich mich deren entledigte. Ich atmete gemeinsam mit meinen Füssen auf. Endlich wieder an der frischen Luft. Augustas veränderte dazu seine Tramp-Strategie und ohne das wir uns versahen, hielt auch schon ein Pick-Up an, der uns bis zu einem Dorf brachte. Dort wurden unsere ausgetrockneten Wasserflaschen wieder aufgefüllt und wir konnten im Schatten eines riesigen Mangobaumes auf ein weiteres Fahrzeug warten.
Wir hatten wenig Lust weiterzutrampen und liebäugelten bereits mit der Möglichkeit, die Nacht auf dem Hofe unserer Fahrer zu verbringen. Hier fühlten wir uns sicher und entspannt. Doch da hielten plötzlich zwei Herren für uns an. “Wir fahren nach Cucutta (Kolumbien).” Was? Wahnsinn! Das war der perfekte Lift für den Tag. Die Männer stellten sich als ehemalige Rekruten des kolumbianischen Militärs heraus. Fünfzehn Jahre hatten sie gedient und befanden sich jetzt im Ruhestand. Wir befragten sie ein wenig über die Guerillas und Paramillitärs. Sie entgegneten darauf, “die gibt es überhaupt nicht.” Das machte uns nachdenklich. Entweder waren es wirklich Hirngespinste, die durch die Presse ihre Runden machten, oder wir waren direkt an Leute von einer dieser Gruppen geraten. Wir hofften, dass es nicht so war…
Wir hielten kurz an, um das Auto mit Öl zu versorgen. Ein weiterer Halt fand an einer Tankstelle statt, wo das Gefährt mit neuer Energie versorgt wurde. Nachdem das Auto gesättigt war, drehten die beiden Herren um und fuhren plötzlich an einem Kreisverkehr entgegen unserer eigentlichen Richtung nach rechts ab. Was war das? Zuvor hatten wir diese Abzweigung passiert und wir erinnerten uns, dass die Beiden in diese Richtung gezeigt hatten und sich dazu etwas sagten. Wir dachten, dass sie nur etwas einkaufen wollten, doch sie passierten die Strassenverkäufer wortlos. Nun befanden wir uns auf einer Strasse, die rein von Feldern und Tierzucht umgeben war. Augustas beruhigte mich zu Beginn noch, doch meine Intuition wusste genau, dass da irgend etwas faul dran war. Ich fühlte mich immer schrecklicher, um so länger wir diese Strasse entlangfuhren. Und schliesslich fing ich an zu fragen.
Ich: “Wo fahren Sie bitte schön hin? Das ist nicht der Weg nach Cucutta.”
Sie: “Doch, das ist er. Der Weg führt geradewegs nach Cucutta.”
Wir: “Unsere Landkarte sagt da aber etwas anderes.”
Sie: “Wir fahren über Puerto Santander und dann direkt nach Cucutta. Das ist der kürzeste Weg.”
Nach Puerto Santander? Wir dachten uns verhört zu haben, doch die Beiden meinten es ernst. Wir, da wir darüber Bescheid wussten, dass zwischen Puerto Santander und Cucutta das Gebiet der Paramillitärs lag und wir ihre Vorliebe für “Weisse” kannten, wollten da auf gar keinen Fall entlang.
Ich: “Das ist doch aber das Gebiet von Paramillitärs. Ich glaube nicht, dass es ratsam für uns ist, dort entlangzufahren.”
Sie: “Heute morgen war es ganz ruhig. Wir sind problemlos über die Grenze gekommen.”
Wir: “Ja, sie sind ja auch keine Ausländer!”
Sie: “Mh. Das stimmt, aber es sollte kein Problem sein, die werden schon nichts tun.”
Wir: “Wissen sie, wir wollen da auf gar keinen Fall entlang. Wir haben keine Lust es auf ‘Gut Glück!’ zu versuchen und dann als Lösegeldmittel festgehalten zu werden. Solch ein Risiko müssen wir wirklich nicht eingehen.”
Sie: “Es kann natürlich sein, dass es für Ausländer wie euch zu Problemen führt… Mh. Wir können euch ja einfach hier herauslassen.”
Wir: “Hier? Das ist ein bischen sehr im Nirgendwo. Könnten Sie die Güte haben, uns wenigstens bis zu dem Kreisverkehr zurückzubringen, damit wir in die richtige Richtung weiterreisen können?”
Nach einigen Diskussionen, die die Beiden unter sich führten, drehten sie endlich um. “Wir werden euch bis La Fria bringen, denn von dort können wir auf unsere Strasse Richtung Puerto Santander weiterreisen.” Gott sei Dank. Mir fiel ein Stein vom Herzen.
Nach langem Hin und Her, in denen unsere Fahrer absolut nicht verstanden, wo wir herausgelassen werden wollten, zudem der Fahrer selbst den Weg nicht kannte und ständig Angst hatte, er würde sich verfahren, stiegen wir entnervt in La Fria aus. Natürlich liessen wir uns das nicht anmerken. Wir dankten den Beiden für die Fahrt und waren froh, sie endlich wieder los zu sein.
Da standen wir nun, an einer durch Autowerkstätten gesäumten Strasse und wussten nicht so recht weiter. Sollten wir zur Autobahn zurücklaufen und weitertrampen? Nein, es war schon zu spät. Wir mussten also einen Zeltplatz finden. Doch wo? Wo war es sicher? Ich ging auf die andere Strassenseite, um in einem Hostel darum zu bitten, unser Zelt aufstellen zu dürfen. Da führte kein Weg hinein, auch weil die Hostelbesitzer die Gegend als zu unsicher dafür einstuften. Sie schlugen aber vor, bei der Stadtverwaltung nachzufragen. Die würden einen sicheren Platz zum Zelten wissen.
Wir liefen also zügig mit unserem Gepäck bis zur Stadtverwaltung. Dort baten wir um Hilfe und im Nullkommanichts erklärte sich eine Sekretärin bereit, sich unserer anzunehmen. “Wenn ich es nicht schaffe, euch einen sicheren Ort zum Übernachten zu organisieren, könnt ihr bei mir zu Hause schlafen.” Unsere Augen leuchteten vor Überraschung und Freude. Man nahm sich unserer an und wir würden die Nacht ruhig hinter uns bringen. Einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren sehr an uns interessiert und so standen wir alle draussen, nach Schatten erheischend, vor dem Gebäude und schwatzten was das Zeug hielt. Die Menschen hier waren aufgeschlossen, neugierig und lustig. Wir hatten so einigen Spass mit ihnen. Außerdem gesellte sich irgendwann ein Venezuelaner zu uns, der sein Leid an die Beamten der Stadtverwaltung herantrug. Er bewegte seine Glieder, als hätte er Hüpfgummisaft getrunken und wippte ständig hin und her. Dazu kaute er auf etwas eigenartigem herum, was ihn ständig einen schwarzen Saft vom Mund abwischen ließ. Gut das er dazu einen Waschlappen benutzte. Augustas war neugierig. “Was haben sie da in ihrem Mund?” Die Beamten lachten und ließen den lustig-wippenden Herren seine “Süssigkeiten” zeigen. Eingewickelt in Bonbonpapier hatte der Herr noch weiter vier Tabak-Bonbons. Er kaute also fleißig auf Tabak herum, was zu diesem unappetitlichen schwarzen Saft und verfärbten Zähnen führte.
Obwohl wir vermuteten, dass uns die Sekretärin zu sich nach Hause schicken wird, kam stattdessen ein Freund der Kirche, der uns in sein Haus einlud. Wir fuhren auf einen Hof, der voller Autoschrott war. “Hier wohne ich”, meinte Eusebio. ‘Gut’, dachten wir, nicht ahnend, dass auch wir hier wohnen würden.
Eusebio stellte uns einigen Persönlichkeiten vor, die sich vor dem Autoschrotthof befanden: eine junge Familie mit drei Kindern, zwei seiner Mitarbeiter und eine Frau. Wir wurden ins Haus gebeten und uns wurde sofort zur Hand gegangen, als wir unser Gepäck dem Auto entnehmen und die Stufen hochtragen wollten. Kaum oben auf der Veranda angekommen und Platz genommen, bombardierte uns Eusebio mit unzähligen, schwierig zu beantwortenden Fragen. Es ging vor allem um Religion, bei der wir ihm eingestehen mussten, keine zu besitzen. Eusebio dagegen war höchst religiös und praktizierte das Ganze aktiv mit seiner Familie. Er hatte insgesamt 13 Kinder, 8 davon mit seiner jetztigen Frau Carmen
. Hinzu kommen ungefähr 9 Enkelkinder. Wir dachten zu Beginn, er würde uns veralbern, denn aller zwei Minuten, wenn jemand die Treppe hinaufkam, und das waren fast ausschließlich Mädchen und junge Frauen, erwähnte er, “Das ist meine Tochter”. Wir fingen an zu lachen, doch lernten später, dass es tatsächlich so war.
Die Familie war einzigartig. Wir waren kaum angekommen, da stimmten die Kinder gemeinsam ab, welchen Raum wir beziehen sollten. Wir hatten vor zu zelten, aber das war in deren Augen unnötig. Es war ja genug Platz da. Also räumte Jessica ihren Raum und zog für die Nacht zu ihrer Schwester. Die Badbenutzung fiel anfangs so aus, dass Augustas und ich getrennt voneinander in ein Bad verwiesen wurden. Die Dusche war köstlich kalt bei den schwülen Temperaturen. Noch bevor wir uns zur Körperreinigung aufmachten, fragten die Kinder nach unseren Essenswünschen. “Arepa?” Ja, gerne. “Yucca?” Sehr gut, aber bitte ohne Butter. “Ei?” Ja, davon könnten wir auch eines vertragen. Nicht lange nachdem wir aus dem Bad wieder herauskamen, wurde uns dann auch schon ein leckeres Mahl serviert. Vor dem Essen schlossen wir unsere Augen und lauschten dem Gebet, dass Jessica diesmal sprach. Wir fühlten uns pudelwohl in der Familie. Neben den vielen Fragen, die uns die gesamte Familie zuwarf, teilten wir auch Minuten völligen Glücks mit der Familie, die durch ein Fussballspiel verursacht wurden.
Die meisten Familienmitglieder leben nicht mehr zu Hause, halten sich dort aber, wenn möglich, den lieben langen Tag auf. Am Abend ging jeder wieder seiner Wege und die Familie Duran lud uns zu ihrem allmontaglichen Familientreffen ein. Dieses bestand in einer christlichen Veranstaltung, während derer Lieder gesungen und Psalme vorgetragen wurden. Zu dem vorgetragenen Psalm musste jeder Anwesende seine Erfahrungen mit Gott und dieser Weisheit teilen. Wir teilten was wir mit ihnen teilen konnten. Belkis, die an jenem Abend die Moderation übernahm, erklärte uns mit tiefster Überzeugung, dass Gott wirklich existiere und ihr in etlichen Momenten zur Seite gestanden hatte. Die anderen Familienmitglieder stimmten ihr genauso überzeugt zu. Am Ende gab es natürlich die Frage, “Und, glaubt ihr nun daran, dass es Gott gibt?” Wir sagten weder ja, noch verneinten wir. Wir erklärten nur mit
unseren Worten, dass es sicher eine Art besondere Kraft geben muss, die die Dinge so geschehen läßt, wie sie passieren. Damit gaben sie sich zufrieden. Nachdem der religiöse Teil abgeschlossen war, war es Zeit zum Spielen. Jessica und Belkis führten Zaubertricks auf, die uns erst verwundern und dann herzlichst lachen ließen. Augustas präsentierte dabei auch gleich seine eigene Magie.
Der Abend war eigentlich schon zu Ende, doch Jessica und Carmen nahmen mich weiter unter Beschlag. Wir spielten ein wenig Flöte, was mir nicht so gut gelang, da sie eine andere Art von Flöte verwendeten als die meinige. Die Mutter rief dann irgendwann zur Nachtruhe auf und wir fielen glücklich erschöpft in einen tiefen Schlaf.
Leider hatten wir am Vortag offen gelassen, wann wir unsere Reise am Morgen fortsetzen wollen. Das führte ungewollterweise dazu, dass es erst gegen 12 Uhr mittags etwas zum Frühstück gab. Wir versorgten uns bis zu dieser späten Frühstückszeit heimlich mit ein paar Bananen und Nüssen, die wir noch vom Vortag übrig hatten. Endlich gab es etwas zu essen. Es war wieder einmal himmlisch. Ich konnte gar nicht genug davon kriegen.
Ein Freund der Familie gesellte sich zu uns und nach einiger Zeit meinte er, “warum fragt ihr nicht einfach einen Busfahrer, ob er euch kostenlos bis Cucutta mitnimmt?” Nun, wie sollen wir das denn anstellen? Möglich ist es theoretisch schon, aber welcher Busfahrer würde denn uns “Touristen” für Luft fahren lassen? “Wer nicht an die Tür klopft, der kann auch nicht wissen, ob sie jemand aufmacht”, waren des Freundes Worte darauf. Wir verließen das Haus also mit ihm zusammen und warteten gespannt auf die Ankunft am Busbahnhof. Dort sprach der Herr mit dem Fahrer des Buses und schon konnten wir hineinhüpfen. Wir fragen uns noch heute, wie er das gemacht hat, aber er hatte Recht gehabt. Und so fuhren wir nun im Bus Richtung kolumbianischer Grenze.
Der Bus war einzigartig. Natürlich alt und klapperig, hatte er doch tatsächlich eine überdimensionale Lautsprecherbox am hintersten Ende angebracht. Wir hatten uns natürlich direkt davor platziert. Es war fürchterlich laut, aber dafür dass wir kostenlos mitgenommen wurden, konnten wir uns einfach nicht beklagen.
Im Bus lernten wir auch zwei junge Kolumbianer kennen, die täglich von Cucutta nach La Fria und zurück fuhren. Sie kauften in Venezuela einen Haufen Lebensmittel ein und verkauften die gesamte Ware dann in Kolumbien für einen höheren, teils den doppelten Preis. Davon läßt sich leben. Doch besteht das Risiko, dass die Grenzbeamten die Ware an der Grenze konfiszieren. Dann haben die beiden eben Pech gehabt. Im Normalfall interessiert sich die Grenzkontrolle aber nicht für Busse, die ständig zwischen Kolumbien und Venezuela verkehren. Ein Glück für die Jungen, die übrigens 17 und 23 Jahre alt waren. Sie stellten sich als Brüder heraus, obwohl sie uns schelmigerweise anfangs eine ganz andere Geschichte auftischten. Der Dreiundzwanzigjährige erzählte uns, dass er bereits vier Kinder hat: neun Jahre alte Zwillinge, einen sechsjährigen Jungen und ein dreijähriges Mädchen. Wir glaubten unseren Ohren nicht trauen zu können und
verstanden auch dies als ein Witz, bis er uns die Fotos der Kinder zeigte. Die Zwillinge hatte er mit einem Mädel, mit dem er nie so richtig zusammen war, die sich heute aber ausgezeichnet verstehen und nur drei Häuser auseinander wohnen. Die anderen beiden Kinder hat er mit seiner jetzigen Frau. Wir waren wirklich baff, anders können wir das nicht sagen.
Das Gespräch mit den Jungen führte fast ausschließlich Augustas, denn ich saß am Fenster und konnte mit der hinter uns dröhnenden Musik einfach kein Wort verstehen. Die Jungen boten uns süsses Brot mit Quark an, was Augustas gerne annahm. Ich musste mit traurigen Augen zusehen, wie diese Leckerei von den Dreien verschlungen wurde. Seufz.
Wir erkundigten uns, ob der Bus an der Grenze in Urena anhalten würde, damit wir aus Venezuela emmigrieren und in Kolumbien immigrieren konnten. Leider hatten die Busfahrer dafür keine Zeit und so stiegen wir in Urena aus. Ich hatte zuvor ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, einfach mit dem Bus bis Cucutta weiterzufahren. Dann würden wir zwar keine Stempel haben, könnten aber am Cucutta Flughafen versuchen, das nachzuholen. Davon hatten wir nämlich gehört. Nur saß uns noch die Erfahrung mit Guatemala im Nacken, in der wir glatt von der Immigrationsbehörde zurück nach Belize geschickt wurden. Auch wenn wir es nie gemacht haben, geschwitzt haben wir beim Verlassen von Guatemala allemal und das nicht nur wegen der Sonne…
Wir stiegen also aus, was sich als sehr unglücklich erwies. Wir befragten die Grenzsoldaten, ob wir an der Grenze in Urena unsere Ausreisestempel bekommen könnten. Diese erklärten uns, dass es in Urena kein Immigrationsbüro gebe und wir dafür nach San Antonio de Tachira müssten. Irgendwie endete aber das Gespräch damit, dass wir bis nach Kolumbien passieren konnten und dort sehen sollten, ob sie uns ohne Ausreisestempel von Venezuela in Kolumbien einreisen lassen würden. Wir liefen also mit unserem ganzen Gepäck ungefähr eine halbe Stunde, bis wir an der kolumbianischen Seite angekommen waren. Dort erklärte man uns aber auch, dass es kein Immigrationsbüro an dieser Grenze gäbe. Sie öffneten uns nur insofern den Weg, dass sie uns vorschlugen, einen Bus zum Cucutta-Flughafen zu nehmen und dort die kolumbianische Aufenth
altsgenehmigung zu beantragen. Was wäre, wenn wir uns zum Flughafen aufmachen würden und dort keine Einreisestempel bekämen, bloss weil wir keinen Ausreisestempel von Venezuela hatten? Das hieße ‘Kehrt marsch!’. Wir entschieden uns also lieber die halbe Stunde (und länger) Rückweg zu Fuss nach Urena anzutreten und dort einen Bus bis San Antonio de Tachira zu nehmen.
Kaum waren wir in Tachira angekommen und fragten die erstbeste Person nach dem Weg zur Grenze, wurden wir auch schon gewarnt: “An der Grenze sind seit drei Tagen Aufstände. Ich würde ihnen da nicht empfehlen mit ihrem Gepäck aufzutauchen.” Die Grenze war blockiert, weil in Kolumbien ein Tarif für das Passieren der Grenze eingeführt worden war. Jeder Autofahrer – ob Kolumbianer oder Venezuelaner – musste je Übergang 1 Dollar bezahlen. Das bedeutete für die, die zwischen den Grenzen berufsmäßig hin- und herfuhren, dass sie am Tag teils bis zu fünf oder mehr Dollar nur für das Überqueren der Grenze aufbringen mussten. Dagegen setzten sie sich mittels der Grenzblockaden zur Wehr. Der ältere Herr, den wir um den Weg gefragt hatten, war so ausschweifend in seinen Erklärungen, dass wir von der Idee, heute noch nach Kolumbien Einzug zu halten absahen. Es galt also einen geeigneten Ort für die Sicherung unseres Gepäcks und unseres Zeltes für die Nacht zu finden.
Wir machten uns also wieder zur Stadtverwaltung auf. Dort war der Kontakt diesmal etwas schwieriger bzw. fehlte es ein wenig an Aktionsfreude, um uns sicher durch die Nacht zu bringen. Wir halfen also ein wenig nach und baten die Feuerwehrzentrale anzurufen. Dort sollten die Beamten für uns nachfragen, ob wir für eine Nacht unterkommen könnten. Das klappte wie am Schnürrchen. Wir wurden von einem Beamten zum richtigen Bus gebracht, der Busfahrer ließ uns nahe der Feuerwache heraus und schon standen wir vor dem amtshabenden Feuerwehrmann. Er hieß Marco, was ich lustig fand, da das der Name meines Bruders war. Wir verstanden uns auf Anhieb gut und nach einem kurzen Schwätzchen wurde, statt eines Stück Rasens zum Zelten, jedem von uns ein eigenes Bett im Gemeinschaftsschlafraum angeboten. Was für ein Glück! Wir probierten gleich die Matrazen aus, die noch neu zu sein schienen. Herrlich! Wir nahmen sogleich eine eiskalte Dusche mit Gänsehaut verursachendem Wind, denn in dem Duschraum fehlte ein Fenster. Aber egal, es war außer dem eisigen Wind, der in Tachira herrschte, doch recht warm. Danach hieß es Essen kochen. Uns wurde die Küche gezeigt, in der wir “alles” verwenden konnten. Das “alles” bestand aus mehrfachbenutztem Öl und dreckigem Geschirr. Guten Appetit, dachten wir. Gut, dass wir unsere eigenen Kochutensilien hatten. Wir mischten uns ein leckeres Mahl mit Reis, Linsen und dem restlichen Gemüse, dass wir noch besaßen. Dazu schmackhafte Gewürze wie Oregano und Curry und schon duftete es nach einem exzellentem Menü. Wir genossen es auf tiefste und verließen die Küche mit überfüllten Mägen. Augustas wollte unbedingt Billard spielen, also taten wir es. Ich verlor natürlich mit Bravour, was mir die Motivation nach drei Spielen dann doch irgendwie nahm. Aber trotz allem verlieren hatten wir einen Heidenspass dabei. Nun war es Zeit fürs Bett, denn wir wollten schon um 5 Uhr morgens wieder aufstehen.
Gesagt, getan. Wir schlichen uns morgens frühzeitig aus dem Zimmer und bereiteten ein karges, aber doch füllendes Frühstück vor. Wir hatten am Vorabend in dem vor Leere gähnendem Kühlschrank unsere halb zermanschte Banane gelassen, damit wir sie am Morgen noch verzehrfreudig vorfanden. Leider hatte es da Jemand wohl in der Nacht nötig gehabt, seinen Magen zu füllen, so dass unser Goldstück am Morgen weg war.
Wir erhielten an diesem Morgen freudige Nachrichten von den Feuerwehrleuten. “Die Grenze ist offen, die Situation unter Kontrolle.” Ja toll, auf was warten wir noch? Um absolut sicher zu sein, dass die Grenze offen ist, fuhr sogar noch einer der Feuerwehrleute schnell auf einem Moped dort vorbei. Wir zogen also zu Fuß los, da es gar nicht so sehr weit war. An der Grenze angekommen, fragten wir ausgerechnet die Grenzsoldaten, wo denn das Immigrationsbüro sei. Einer dieser Soldaten befand sich als so autoritär, dass er uns mit einer arroganten Armbewegung zu einem Büro verwies. Das Büro war geschlossen, so dass wir ins Gebäude eintraten, um eventuell doch jemanden anzutreffen. Doch da war absolut niemand. Wir kamen gerade wieder heraus aus dem Gebäude, da strebte der arrogante Soldatenhals auf uns zu und fragte uns, in einem Ton als wären wir seine Rekruten, was wir wollten. Ja, was wohl? Vielleicht emmigrieren? Man… Wir erklärten ihm, dass wir nach Kolumbien wollten. Er wies uns an zu warten, bis das Büro öffnete. Das wäre dann so in 45 Minuten oder so. Vielen Dank. Hätten wir mal bloß nicht nachgefragt und wären einfach schnurstracks nach Kolumbien spaziert. Mehr als zurückschicken hätten die uns auch nicht können. Zumindest wären wir dann wohl diesem arroganten Schnösel nicht begegnet. Es half also alles nichts, wir waren gezwungen vor dem Büro zu warten und zwar direkt neben dem Grenzverkehr, der eine derarte Luftverschmutzung ausübte, dass ich mir, als wäre ich ein Räuber, mein rotes Tuch über Nase und Mund schnüren musste. Damit war es zumindest möglich, die Abgase ein wenig zu filtern und die eine Stunde Warten zu überleben. Neben der Überschwemmung mit Autoabgasen, bemerkten wir, dass sich die Grenzpolizei nicht im Geringsten dafür zu interessieren schien, wer von Kolumbien nach Venezuela und umgekehrt unterwegs war. Niemand wurde angehalten. Niemand musste sich ausweisen. Das fanden wir reichlich merkwürdig. Auf Nachfrage erfuhren wir später, dass sich aufgrund eines bestimmten Abkommens, Kolumbianer wie auch Venezuelaner innerhalb eines begrenzten Gebiets zwischen Kolumbien und Venezuela frei bewegen können, ohne Kontrolle. Ach so. Wir konnten auch beobachten, wie einigen Kolumbianern leere Benzinkanister entzogen wurden, da die Absicht, billiges Benzin in Venezuela einzukaufen und es teuer in Kolumbien zu verkaufen klar auf der Hand lag. Das Verbot, Benzin von Venezuela nach Kolumbien zu bringen, also mehr als in den Tank des Autos passt, war jedem Fahrer bewusst und trotzdem versuchten sie es. Mit einem verschmitzten Lächeln akzeptierten sie den Entzug der Benzinkanister.
Jetzt kam ein neues Problem auf uns zu. Wir lasen an der Scheibe des Büros, ‘Emmigration 37,000 Bolivars’. Das hieß, wir müssten pro Person knapp 16 Euro für unsere Ausreise bezahlen. Hinzu kam ein weiteres Problem: wir hatten keinen einzigen Bolivar mehr. Wir überlegten fieberhaft was wir tun könnten. Wir entschieden uns, dem Bürobeamten einen 10 Dollar Schein anzubieten, damit er uns ziehen läßt. Wenn das nicht klappen sollte, müssten wir zurück nach Tachira laufen, unser Geld zum offiziellen Umtauschkurs (der alles andere als rosig war) wechseln und zurück zum Immigrationsbüro, um uns sozusagen freizukaufen.
Da kam endlich der Immigrationsbeamte. Er schien sich ausgesprochen gut mit unserem arroganten Soldaten zu verstehen. Das bedeutete für mich schon mal schlechte Karten. Vielleicht sollten wir doch lieber zur Bank gehen. Augustas versuchte es trotzdem. Da fragte der Beamte, “Wieviel ist denn 10 Dollar in Bolivar?”. Augustas konnte nun schlecht loslügen, was dazu führte, dass wir postwendend zur Bank geschickt wurden. Ich wartete derweil vor dem Immigrationsbüro. Als Augustas wiederkam, sah er richtig glücklich aus. “Was ist denn los?” Nun, Augustas hatte es geschafft, das Geld in einem offiziellen Umtauschbüro für 3.300 Bolivar pro Dollar zu tauschen. Normalerweise liegt der Kurs bei 2.100 Bolivar je Dollar. Wir konnten uns glücklich schätzen. Beim Begleichen der Ausreisegebühr rundete der Beamte plötzlich auf. Der genaue Betrag war ungefähr so: 36.342 Bolivar. Und exakt das wollten wir bezahlen. Der Beamte wollte aber gleich einmal 37.000 Bolivar haben. Vielleicht handelt es sich hier nur um ‘einen Appel u
nd ein Ei’. Uns ging es aber ums Prinzip. Wir legten ihm also die genaue Gebühr auf den Tresen, bekamen endlich unsere Stempel und weg waren wir.
Wir liefen auf die kolumbianische Seite zu. Dazu mussten wir eine Brücke überqueren. Als wir auf die Brücke kamen, sahen wir einen Bus quer geparkt auf der Strasse. Er versperrte den Weg für jeglichen Transport über die Grenze hinweg. Es schien sich eine erneute Blockade der Grenze anzukündigen. Während wir weiterliefen, kamen plötzlich 12 schwarz gekleidete, vollmontierte, mit jeglich denkbaren Waffen ausgestattete “Robocops” (Sondereinsatzkommando) auf uns zu. Das Schutzschild in der einen Hand, den Knüppel in der anderen, kamen sie mit ihren muskelabzeichnenden Uniformen auf uns zu. Oh oh… “Lass uns nur schnell weiterlaufen, nicht das wir direkt in die Auseinandersetzung hineingeraten”, waren Augustas Worte. Wir legten also einen Schritt zu, um diesen etwas merkwürdigen Gestalten auszuweichen. Ich hatte das Gefühl, dass sie wie in Zeitlupe an uns vorbeizogen. Dabei waren sie so aufgestellt, dass sie in einer Reihe, die gesamte Breite der Brücke einnahmen. Flux waren wir vorbei und schlüpften in das Immigrationsbüro. Dort interessierte sich, ärgerlicherweise, niemand für unseren Ausreisestempel von Venezuela. So ein Theater also für nichts, rein gar nichts. Naja, jetzt war es nicht mehr zu ändern. Zumindest wussten wir jetzt genau, wie es die kolumbianischen Immigrationsbeamten mit der Kontrolle der Reisepässe hielten.
Wir hörten, dass sich der Aufstand auf der Brücke wieder aufgelöst hatte. Wir liessen uns noch erklären, wie wir Cucutta am Besten umgehen konnten und schon standen wir an der Strasse und hielten unseren Daumen hoch. In Venezuela haben wir immer nur zu hören bekommen, “Da hält nie einer für euch an!”. Das Gegenteil stellte sich heraus. Fest davon überzeugt, dass wir die Grenze mit einer Mitfahrgelegenheit anstatt mit einem Bus verlassen würden, hob ich meinen Arm. Der Daumen zeigte bestimmt nach oben und in nur fünf Minuten hatten wir Glück. Wir bekamen einen Lift zu einer Kleinstadt in der Nähe von Cucutta, von wo aus wir direkt in Richtung Pamplona und Bucaramanga reisen konnten.

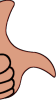










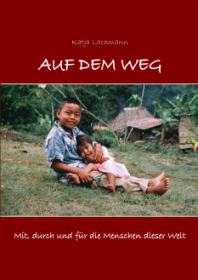
Kommentare
Kommentar schreiben